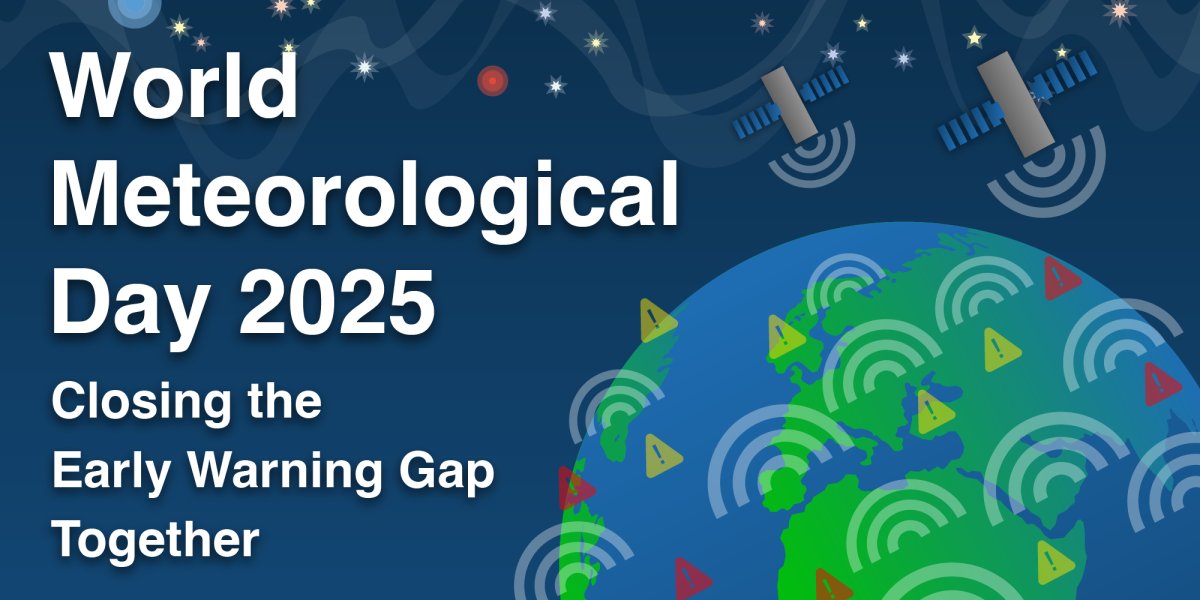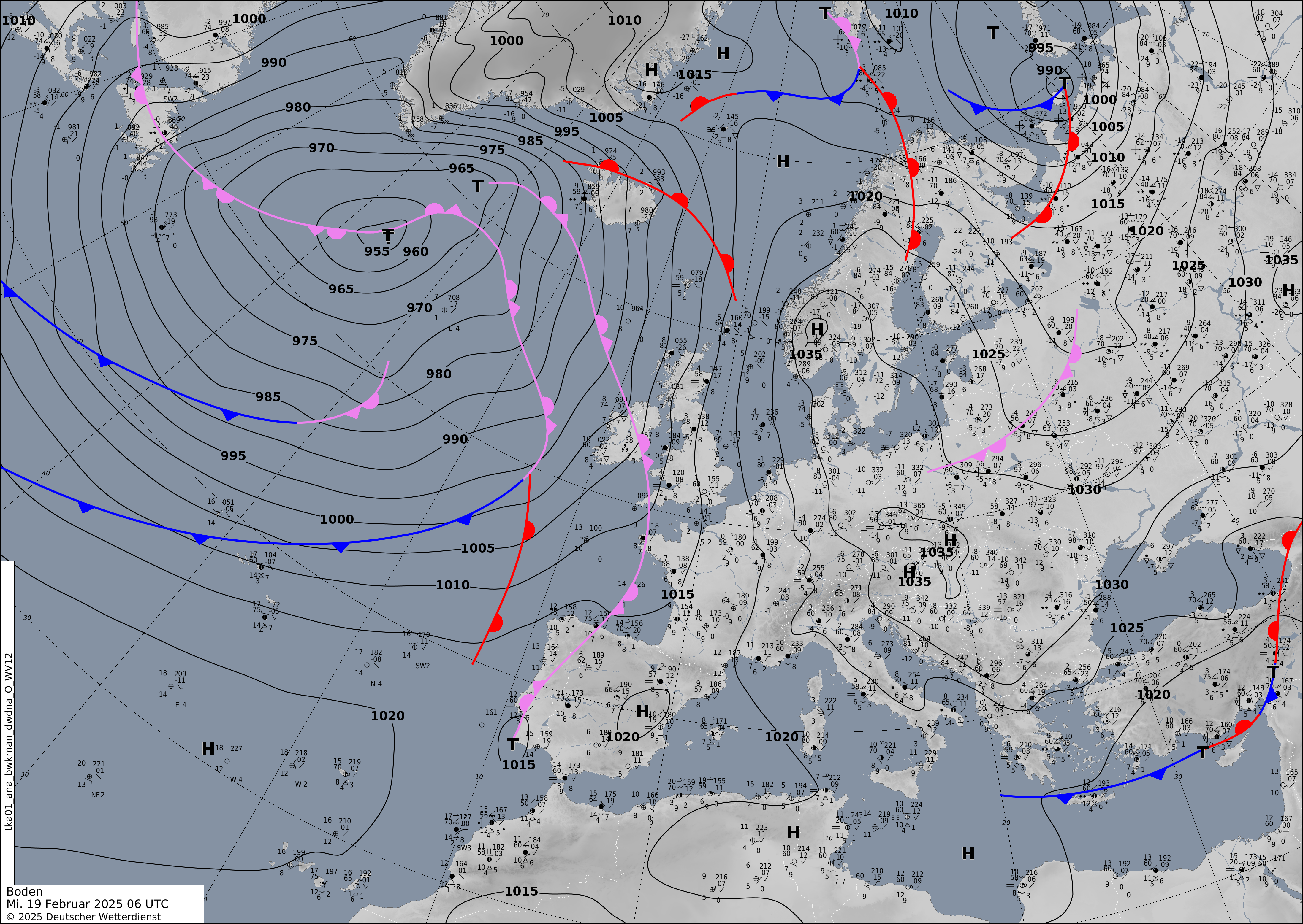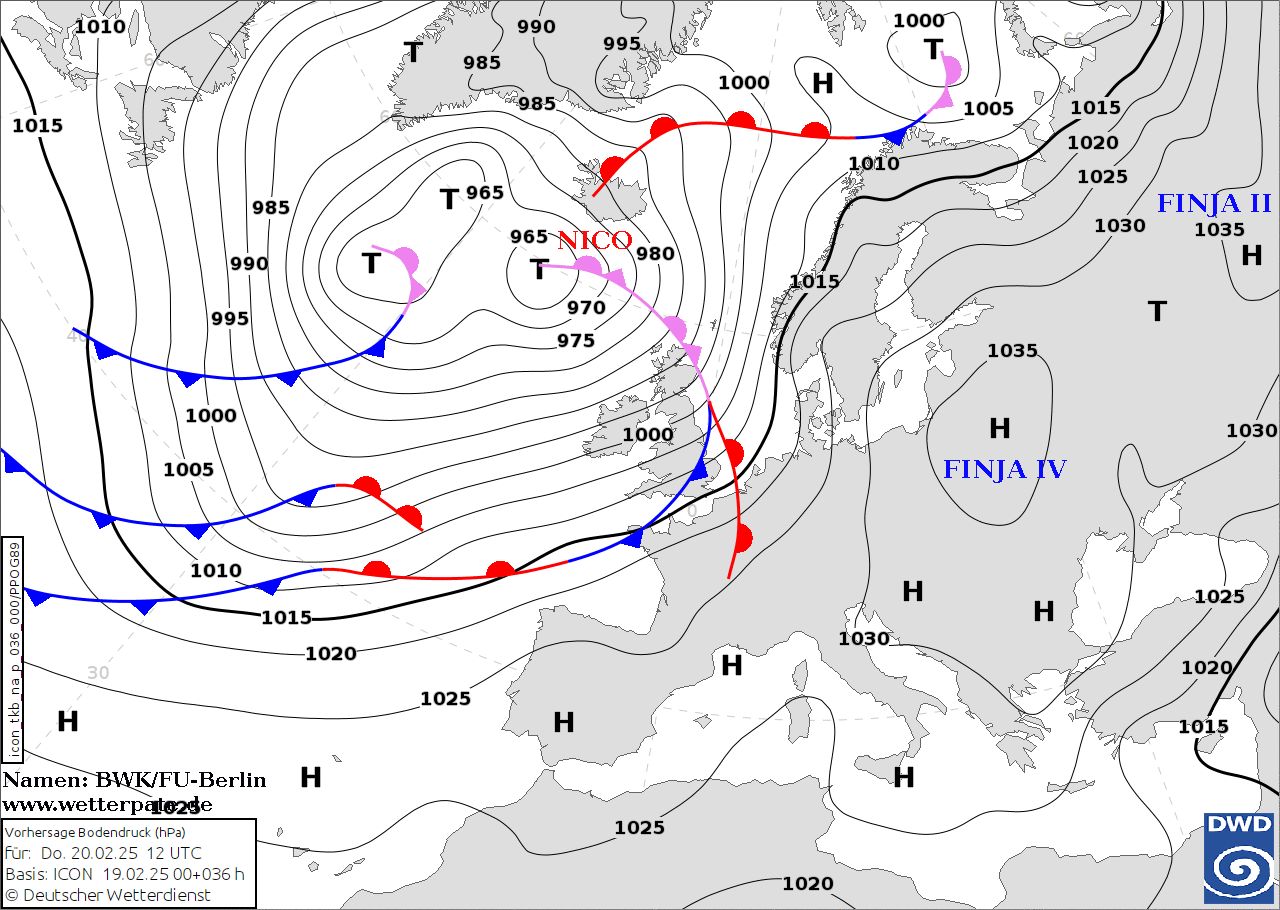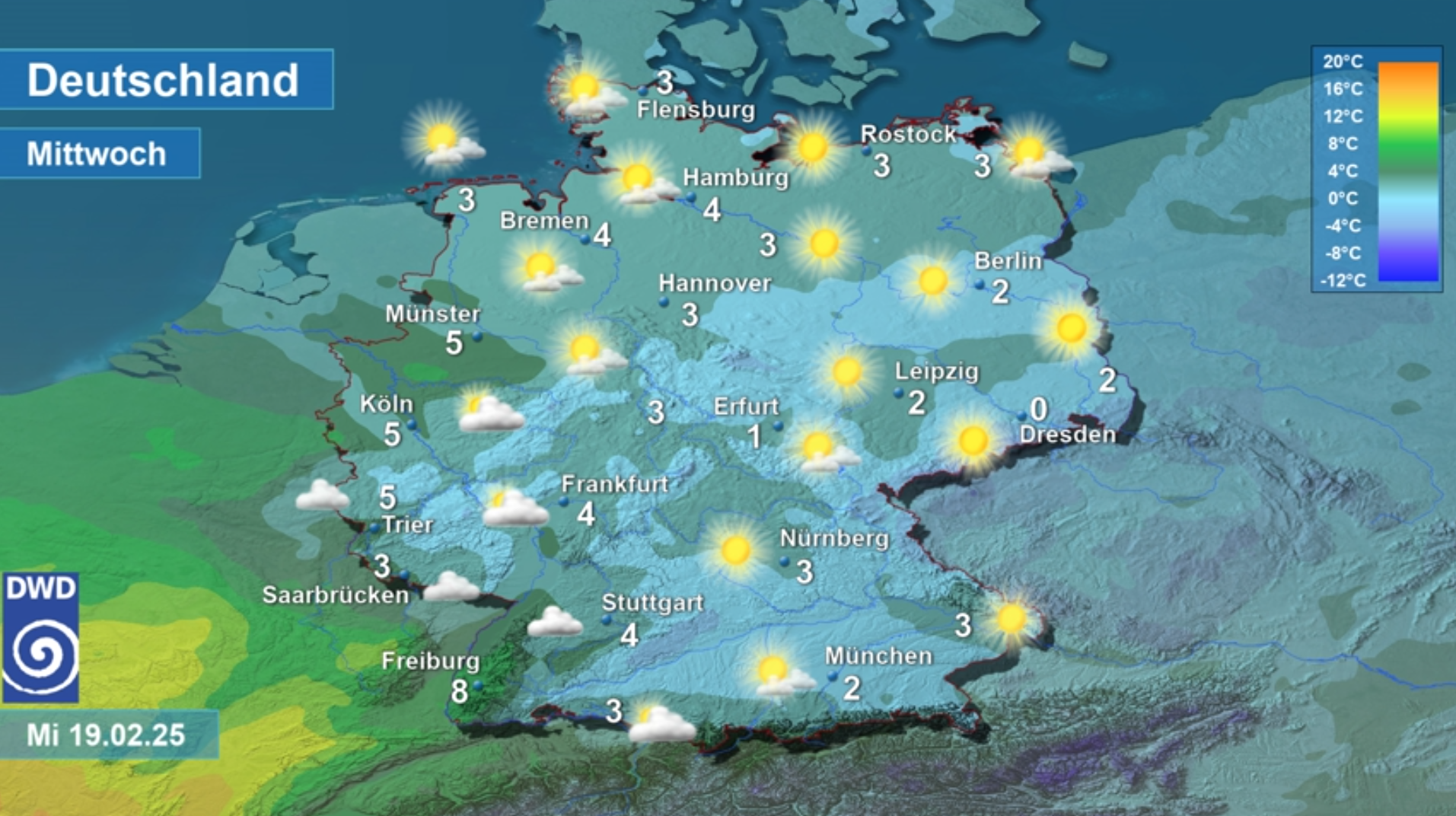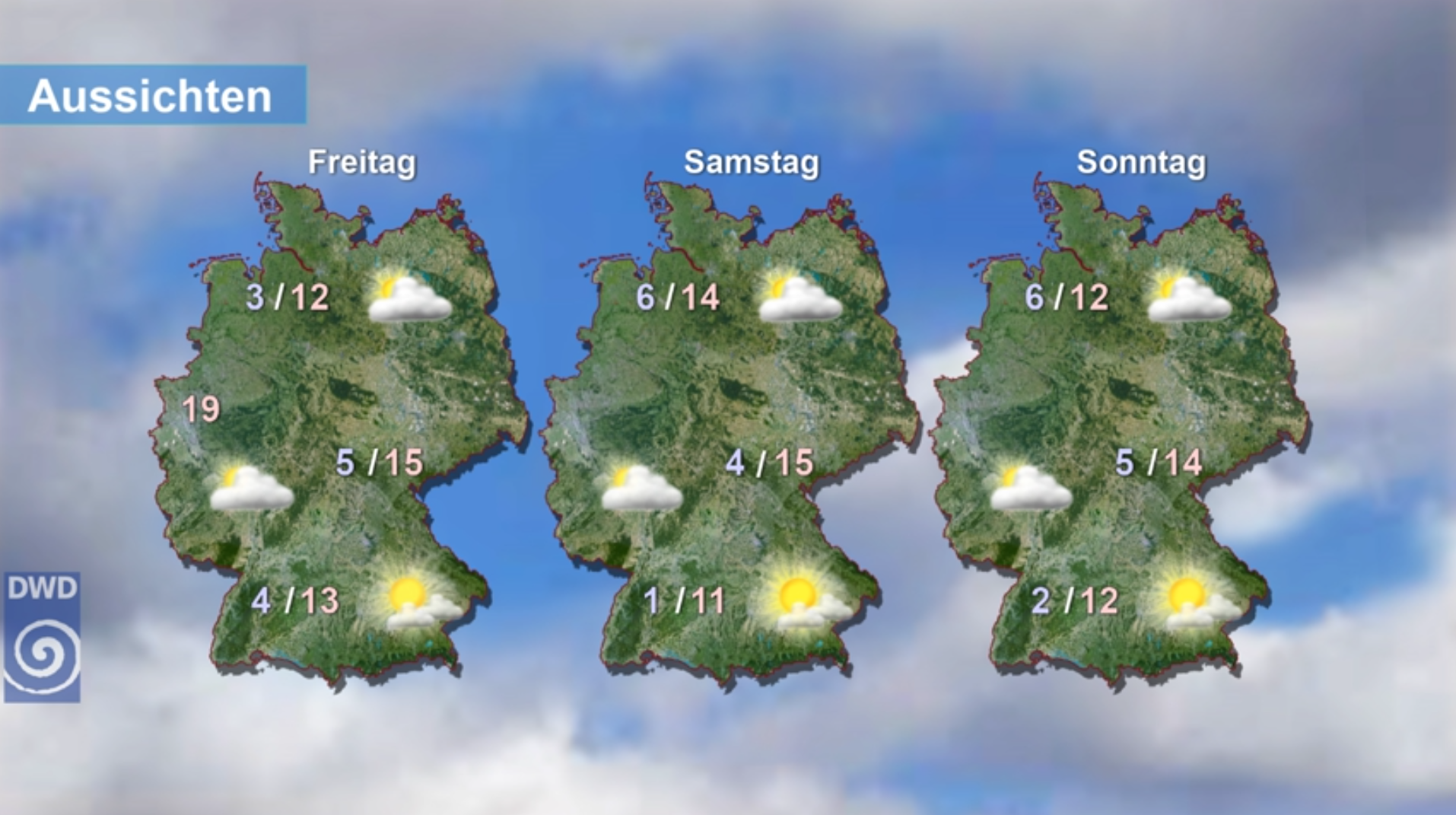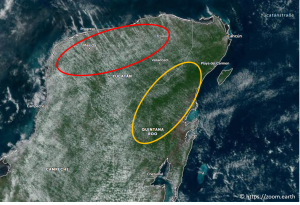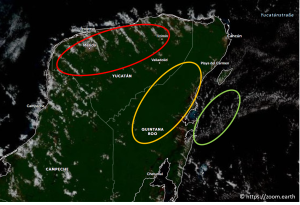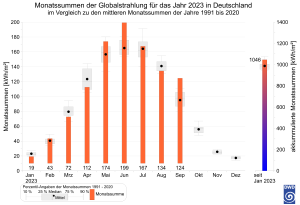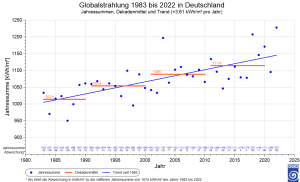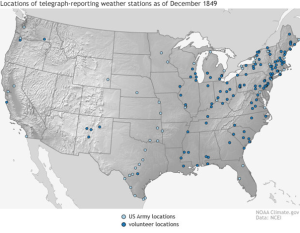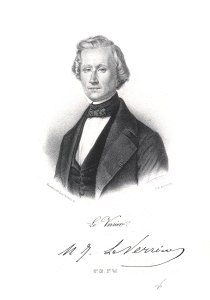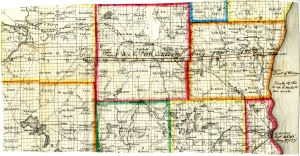Der Welttag der Meteorologie 2025
Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wurde heute vor 75 Jahren am 23.03.1950 gegründet. Diese Konvention ging als Nachfolgeorganisation der zwischen 1873 und 1879 ins Leben gerufenen Internationalen Meteorologischen Organisation (IMO) in Kraft. Die Organisation hat ihren Sitz in Genf in der Schweiz und zählt mittlerweile mehr als 190 Staaten. Ziel ist es, eine friedliche Zusammenarbeit der nationalen Wetterdienste zu ermöglichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vertritt die Bundesrepublik Deutschland seit 1954.
Jedes Jahr steht der Tag der Meteorologie unter einem bestimmten Thema, welches für die aktuellen Herausforderungen im Bereich Wetter und Klima sowie den verwandten geophysikalischen Wissenschaften von großer Bedeutung ist. Dieses Jahr ist das Motto: „Closing the early warning gap together„. Dabei geht es darum, in Zusammenarbeit mit den einzelnen nationalen Wetterdiensten und wissenschaftlichen Institutionen die Frühwarnlücke zu schließen, um Wetterwarnungen für jeden weltweit zur Verfügung zu stellen!
Diese Grafik zeigt das Logo des diesjährigen Welttags der Meteorologie. (Quelle: WMO)
Gerade in Verbindung mit dem weiter voranschreitenden Klimawandel erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für extreme Wetterbedingungen. Ein Beispiel dafür sind sich rapide intensivierende tropische Wirbelstürme, heftige Regenfälle mit großräumigen Überschwemmungen, Sturmfluten, aber auch ausgeprägte Dürreperioden mit Wald- und Buschbränden. Von diesen Extremereignissen sind vor allem auch dicht besiedelte Regionen in Entwicklungsländern betroffen, die häufig keinen oder nur begrenzten Zugang zu modernen Frühwarnsystemen haben. Diese retten aber im Extremfall nicht nur Menschenleben, sondern verringern in einer globalisierten Welt auch wirtschaftliche Risiken bei uns.
Dazu wurde die Initiative „Early Warnings for All“ im Jahre 2022 ins Leben gerufen. Seitdem wurden bereits große Fortschritte erzielt. So konnten durch die Ausdehnung effektiver Frühwarnsysteme die Zahl der Todesopfer und die wirtschaftlichen Schäden bei Extremwetterereignissen deutlich reduziert werden. Während im Jahr 2015 lediglich 52 Länder Zugang zu umfangreichen Frühwarnsystemen hatten, waren es im Jahr 2024 bereits 108. Doch diese Zahl zeigt auch, dass noch längst nicht alle dabei eingebunden sind. Gerade bei kleineren Inselstaaten mit schwacher Ökonomie bestehen noch deutliche Lücken. Diese haben eine hohe Relevanz, denn sie sind nämlich recht häufig von extremen Wetterbedingungen wie beispielsweise im Zuge von kräftigen tropischen Wirbelstürmen betroffen.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, ist entschlossen, diese noch bestehenden Lücken zu schließen und dafür zu sorgen, dass Frühwarnsysteme innerhalb der nächsten Jahre alle Menschen auf der Erde schützen. Die Initiative „Frühwarnungen für alle“ steht in vollem Einklang mit der globalen Agenda 2030 und unterstützt wichtige Bestimmungen des Sendai-Rahmens für die Verringerung des Katastrophenrisikos, des Pariser Abkommens zum Klimawandel und der Ziele für nachhaltige Entwicklung.
Zur Erreichung des angestrebten Ziels ist neben dem Zusammenschluss der nationalen Wetterdienste und wissenschaftlichen Institutionen auch die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor von großer Bedeutung. Dabei können durch intensiven Wissenstransfer und den Austausch von Technologien Innovationen gefördert und Prozesse beschleunigt werden. Dies ist gerade in einer Zeit, in der staatlich finanzierte wissenschaftliche Institutionen teils aufgelöst und Experten entlassen werden von herausragender Bedeutung, um die angestrebten Ziele weiterzuverfolgen!
M.Sc. Meteorologe Nico Bauer
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 23.03.2025
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst